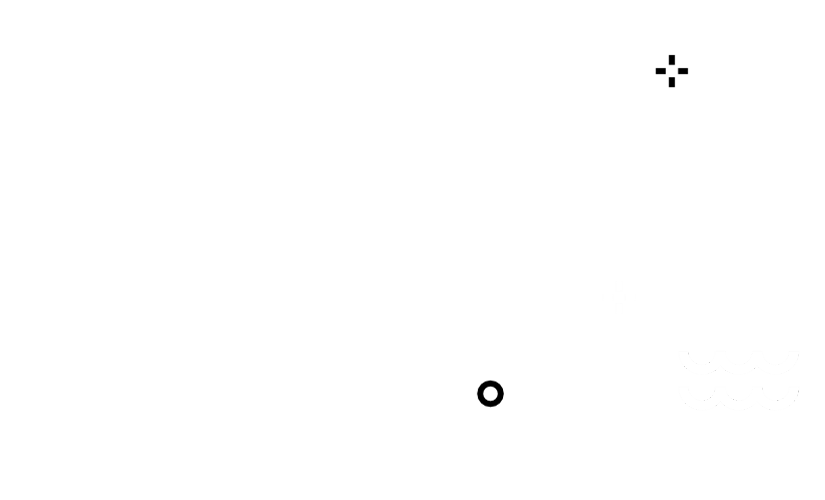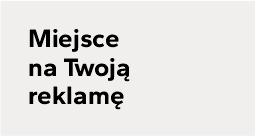Piszemy jak jest. „Bliżej morza już nie będziesz”, czyli apartamentowiec sztormu się nie boi
24 kwi 2024
To już jest prawdziwe szaleństwo! – komentują budowę luksusowego apartamentowca turyści i mieszkańcy Międzyzdrojów. Olbrzymi budynek powstaje niemal na samej plaży, tuż przy granicy Wolińskiego […]